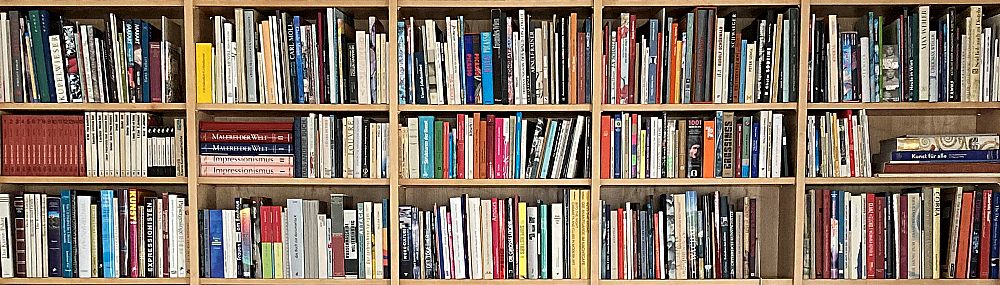„Du wolltest Dich hier als Apostel der Frauenemancipation aufspielen u. solche Deutungen sind zu vermeiden“ – das wurde der Schweizer Mäzenin Lydia Welti-Escher von Seiten ihres Ex-Mannes Friedrich Emil Welti beschieden, als sie plante, mit der von ihr 1890 initiierten Kunststiftung vor allem auch das Schaffen von Frauen zu fördern. Die „Entwicklung und Selbständigmachung des weiblichen Geschlechts“ wurde daher nicht, wie es Lydia Welti-Escher gewünscht hatte, als wesentlicher Stiftungszweck festgelegt. Auch der Stiftungsname wurde auf Druck der Familie des Ex-Mannes geändert: Aus der „Welti-Escher-Stiftung“ wurde die bis heute bestehende „Gottfried Keller-Stiftung“, in der es Lydia Welti-Escher allerdings als Frau untersagt war, Mitglied des Stiftungsrates zu sein – und all das, obwohl die Stiftung mit Welti-Eschers Vermögen begründet worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatte Lydia Escher (die nach der Scheidung wieder ihren Geburtsnamen führte) den Kampf um die eigene „Selbständigmachung“ aber offenbar bereits aufgegeben. Ein Jahr später nahm sie sich, dreiunddreißigjährig, das Leben.

Es war das luxuriöse Leben des Züricher Großbürgertums, in das Lydia Escher 1858 hineingeboren wurde. Ihr Vater, Alfred Escher, war – als Politiker, Unternehmer, Bankengründer und Eisenbahnpionier – einer der vermögendsten und einflussreichsten Männer der Schweiz. Unter anderem war Escher der Initiator des Gotthardbahn-Projektes und Mitbegründer des „Eidgenössischen Polytechnikums“, der heutigen „ETH Zürich“. Die Familie residierte am Stadtrand, im weitläufigen Anwesen Belvoir – das für Lydia Escher allerdings bald zu einem relativ einsamen Zuhause werden sollte. Denn ihre jüngere Schwester Hedwig verstarb im Kleinkindalter, und ihre Mutter, Augusta Escher, als Lydia gerade erst sechs Jahre alt war. Das Mädchen wuchs relativ isoliert in der Obhut von Gouvernanten auf; und von den Gästen, die ins Belvoir kamen – Freunde und Bekannte ihres Vaters –, zeigte nur einer Verständnis für sie und ihre Interessen: Es war der Schriftsteller Gottfried Keller, der seit seiner Jugend mit Alfred Escher bekannt war und der des Öfteren zu Besuch war. Es ist wohl auf diese enge Beziehung zurückzuführen, dass Lydia eingewilligt hatte, ihre Stiftung nach dem Schriftsteller zu benennen.

„Die Schweizer, mit seltenen Ausnahmen, verlangen von ihren Frauen, nebst möglichst ansehnlichem Vermögen, nur denkbar größte Anspruchslosigkeit. Die schweizerische Gattin auch der höheren Stände ist durchschnittlich nichts anderes, als eine Haushälterin, die den Zweck des Daseins erfüllt, wenn sie wenig Geld braucht. Ein glänzendes Wesen, Charme, feinere Bildung würden ihr, von ihrem Gatten und ihrer Umgebung, als Kriminalverbrechen vorgeworfen“, so vermerkte Lydia Escher in ihren „Gedanken einer Frau“ betitelten Aufzeichnungen – und sie beschreibt damit wohl vor allem, wie sie ihre Ehe empfunden hatte. 1883 hatte sie, die nach dem Tod ihres Vaters zur Millionenerbin und reichsten Frau der Schweiz geworden war, Friedrich Emil Welti geheiratet. Auch er stammte aus einer sehr renommierten, einflussreichen Familie: Sein Vater, Emil Welti, gehörte mehr als zwei Jahrzehnte lang dem Schweizer Bundesrat an, er war mehrfach Bundespräsident – und er erwartete von seiner Schwiegertochter ein den konservativen Normen und Usancen der helvetischen Patriziergesellschaft entsprechendes Leben. Aus diesem sollte Lydia jedoch in dramatischer Weise ausbrechen.
Ein ehemaliger Schulkollege von Lydia Eschers Ehemann war der Maler Karl Stauffer-Bern, der in München studiert und dann in Berlin Karriere gemacht hatte. Stauffer-Bern war als gefragter Porträtist immer wieder auch in der Schweiz tätig, und Friedrich Emil Welti beauftragte ihn, Lydia zu malen. „Damit war das Unheil da“, schrieb später der Schriftsteller Theodor Fontane, der Stauffer-Bern aus Berlin gekannt hatte und der Anteil an Lydia Eschers Schicksal nahm: „Das Portrait der Frau Welti geb. Escher wurde für diese verhängnißvoll“, denn sie und Karl Stauffer-Bern verliebten sich ineinander und brannten eines Tages miteinander nach Rom durch, wo Stauffer-Bern ein Atelier hatte. „Ganz Zürich stand Kopf; das Patriziat entsetzt“, berichtete Fontane. Lydia Eschers Ehemann und ihr Schwiegervater setzten – unterstützt, wie Fontane betont, durch das „Schweizerische Cliquenwesen“ – alle Hebel in Bewegung und veranlassten, „daß man, durch den Schweizerischen Gesandten in Rom, die römische Polizeibehörde dahin brachte, sofort energisch einzugreifen“. Ein von der Gesandtschaft beauftragter Arzt erklärte Lydia Escher für geisteskrank und ließ sie, in Absprache mit Friedrich Emil Welti, in einer „Irrenanstalt“ internieren. Karl Stauffer-Bern wurde auf Betreiben der Familie Welti der Entführung und Vergewaltigung einer Geisteskranken und der Veruntreuung eines höheren Geldbetrages angeklagt und für mehrere Wochen inhaftiert. Als sich die Anschuldigungen als nicht gerechtfertigt und die Vorgehensweise als nicht gesetzeskonform erwiesen, wurde er zwar aus dem Gefängnis entlassen, aber ebenfalls in eine „Irrenanstalt“ gebracht. Erst nach rund vier Monaten kam er frei, zur selben Zeit war auch Lydia Escher entlassen worden, nachdem zwei von einem italienischen Untersuchungsrichter beauftragte Psychiater festgestellt hatten, dass sie „im Besitze ihrer völligen geistigen Integrität“ sei. Zurück in der Schweiz ließ sich Lydia Escher von ihrem Mann scheiden. Zu Karl Stauffer-Bern hatte sie jedoch in der Folge keinen Kontakt mehr. Der hochemotionale Künstler war durch die Geschehnisse psychisch völlig zerstört, und nahm sich im Januar 1891, rund elf Monate vor Lydia Escher, das Leben.

Die Briefe, die Karl Stauffer-Bern an Lydia Escher geschrieben hatte, übergab diese kurz vor ihrem Tod an den Berliner Feuilletonisten Otto Brahm, der mehrere Artikel über Stauffer-Bern geschrieben hatte. Lydia Escher bat Brahm, die Briefe – ganz im Sinne von Stauffer-Bern – zu veröffentlichen, die Originale schenkte sie ihm. Die Herausgabe wurde vorbereitet, doch nach Eschers Tod erreichte Brahm „ein seltsamer Einspruch: die hohe Eidgenossenschaft (…) wollte Besitzerin der Briefe sein und – dies vor Allem – die Publikation untersagen.“ Der Einspruch – hinter dem vermutlich erneut „Macht und Geld“ standen (auf deren Einfluss Stauffer-Berns Bruder Eduard bereits bei der Verhaftung Karls verwiesen hatte) – entbehrte jeglicher gesetzlicher Grundlage. „Aber gerade das Vorgehen der Eidgenossenschaft war es, was mich zu weiterer Arbeit jetzt energisch aufforderte“, schrieb Otto Brahm 1892 in einem Artikel in der „Frankfurter Zeitung“ (4.9.1892). Noch im selben Jahr veröffentlichte er ein später mehrfach neu aufgelegtes Buch über Karl Stauffer-Bern, das auch die Briefe enthält. Otto Brahm war es auch, der Theodor Fontane auf das Beziehungsdrama rund um Lydia Escher und Karl Stauffer-Bern aufmerksam machte. „Die Tragödie mit Held und Heldin macht großen Eindruck auf mich“, schrieb Fontane in einem Brief an Brahm (30.12.1891) – und es ist anzunehmen, dass ihn die Geschehnisse bei der Gestaltung seines Romans „Effi Briest“ beeinflusst haben.
Bücher über Lydia Escher:
Regina Dieterle: ‚Zu sehr emancipirt‘. Lydia Eschers Tragödie. Verlag Nimbus. Kunst und Bücher, Wädenswil 2019.
Lukas Hartmann: Ein Bild von Lydia. Roman. Diogenes Verlag, Zürich 2018. Auch als E-Book erhältlich.
Stef Stauffer: Die Signora will allein sein. Roman. Münster Verlag, Basel 2017. Auch als E-Book erhältlich.
Joseph Jung: Lydia Welti-Escher (1858–1891). Biographie. Verlag NZZ Libro, Basel 2016.
17.8.2019