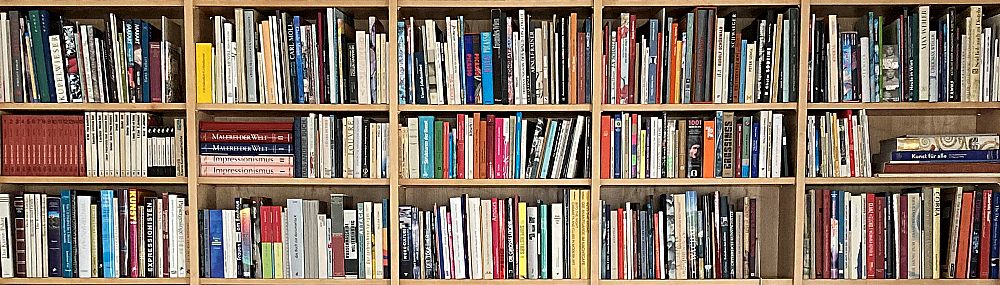„Önnenki iesi ichmi erstehenvi?“ – Verstehen Sie diesen Satz? Vermutlich nicht gleich auf den ersten Blick. Auf den zweiten aber wird vielleicht schon klar, dass hier ein wenig umgestellt und ergänzt wurde: Bei jedem Wort wurde der Anfangskonsonant ans Wortende gesetzt und dann jeweils noch ein -i angehängt. Also: önnen-K-i ie-S-i ich-m-i erstehen-v-i. Somit bedeutet diese merkwürdige Buchstabenreihe nichts anderes als: „Können Sie mich verstehen?“
Es handelt sich dabei durchaus nicht um eine absurde Sprachspielerei, sondern um eine historische Geheimsprache. Es ist die Kedelkloppersprook, die Kesselklopfersprache, die von Arbeitern im Hamburger Hafen bis in die 1930er Jahre gesprochen wurde. Die Aufgabe der Kedelklopper war es, die Kessel der Dampfschiffe zu reinigen und die Kalkablagerungen abzuhämmern.
Die Kedelkloppersprook ist ein Beispiel für die vielen Formen sprachlicher Verfremdung, mit denen sich Christian Efing und Bruno Arich-Gerz in dem Buch „Geheimsprachen. Geschichte und Gegenwart verschlüsselter Kommunikation“ beschäftigen. Als Geheimsprache definieren die beiden Sprachwissenschaftler, „eine Kommunikationsform, die entweder auf einem sprachlichen Code basiert, den nur Eingeweihte beherrschen“ – so wie eben die Kedelkloppersprook –, oder eine Kommunikationsform, „die durch Mischsprachlichkeit für Außenstehende nicht entschlüsselbar ist.“
Die im deutschen Sprachraum bekannteste jener Geheimsprachen, die auf dem Mischen verschiedener Sprachen basieren, ist das Rotwelsch. Es hat sich ab dem 13. Jahrhundert als ein Idiom von nicht-sesshaften Bevölkerungsgruppen herausgebildet und vor allem Begriffe aus dem Jiddischen, dem Romanes (der Sprache der Sinti und Roma) und – zu Beginn – auch aus dem Lateinischen in seinen Wortschatz aufgenommen. Verwandt mit dem Rotwelsch ist das Jenische, dem Efing und Arich-Gerz in ihrem Buch einen großen Abschnitt widmen. Auch heute noch wird es – in Süddeutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz – in einzelnen Gemeinden gesprochen (wobei die Jenischsprechenden meist seit Generationen nicht mehr zum „fahrenden Volk“ gehören). Als Beispiel bringen Efing und Arich-Gerz das Lützenhardter Jenisch, das seit dem 18. Jahrhundert in der Schwarzwaldgemeinde Lützenhardt gesprochen wird und auch gut dokumentiert ist.
Anders als Rotwelsch und Jenisch ist das Oshideutsch eine weithin unbekannte Geheimsprache. Bruno Arich-Gerz, der so wie Christian Efing als Linguist an der Bergischen Universität Wuppertal tätig ist, beschäftigt sich in seiner Forschung mit dieser Sondersprache, die eine deutsch-afrikanische Mischung ist. Denn das Oshideutsch geht auf jene rund 430 Kinder zurück, die zwischen 1979 und 1990 als Flüchtlinge aus Namibia in die DDR kamen. Untergebracht in einem Kinderheim in Mecklenburg erhielten sie dort ihre schulische Ausbildung: „Unterrichtssprache war Deutsch, während als Umgangssprache mit den pädagogischen Kräften aus Namibia das Oshivambo fungierte“, die Muttersprache der Kinder. Aus den beiden Sprachen entwickelten die Kinder eine Mischform, die nur für sie verständlich war und einen kommunikativen Freiraum bildete, der den LehrerInnen und BetreuerInnen nicht zugänglich war. Mittlerweile leben die meisten wieder in Namibia und haben das Oshideutsch als Gruppensprache bewahrt: „Denn Gelegenheiten, sich zu treffen, gibt es nach wie vor, der Zusammenhalt der Gruppe ist groß und vor zehn Jahren wurde in der namibischen Hauptstadt Windhoek sogar ein ‚Freundeskreis Ex-DDR‘ gegründet.“
Im Gegensatz zu diesen Mischsprachen ist die eingangs beschriebene Hamburger Kedelkloppersprook eine code-basierte Geheimsprache. Derartige Sprachen, die auf einem speziellen Verschlüsselungssystem basieren, bei denen die Grundsprache in ihrem Wortschatz nicht verändert wird, gibt es weltweit in einer riesigen Zahl. Zur Anwendung kommen die unterschiedlichsten Codierungsverfahren: Manchmal werden die Vokale verändert, manchmal Silben verschoben, manchmal lautliche Elemente eingefügt. In der geschriebenen Form sind derartige Geheimsprachen meist relativ leicht zu entschlüsseln, gesprochen aber sind sie für alle jene, die nicht den Code kennen, kaum verständlich. Beliebt sind code-basierte Geheimsprachen vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen. Eines der Vorbilder ist dabei die „Räubersprache“ aus Astrid Lindgrens drei Romanen rund um Kalle Blomquist. Bei dieser Räubersprache werden die Konsonanten eines Wortes verdoppelt und zwischen sie ein -o- eingesetzt – aus dem Wort „Räubersprache“ wird so ein „Roräuboberorsospoprorachoche“.
„Diese Verfremdungsverfahren wirken auf den ersten Blick sehr analytisch und damit schwierig fließend zu sprechen. Da schon Kinder im Vorschulalter aber einen intuitiven, unbewussten Zugang zur Silbenstruktur deutscher Wörter haben (…), gelingt es Schülern problemlos, diese Geheimsprachen in normaler Fließgeschwindigkeit zu sprechen – und das fällt ihnen vermutlich leichter als die analytische, bewusste Erklärung dessen, was sie genau tun, wenn sie eine code-basierte Geheimsprache sprechen“, schreiben Christian Efing und Bruno Arich-Gerz. In ihrem hochinteressanten Buch berichten die beiden überdies von berühmten verschlüsselten Sprachen, wie etwa der Linear-B der Mykener und der „Lingua Ignota“, die Hildegard von Bingen verwendete; sie beschäftigen sich mit dem geheimnisvollen und trotz vieler Versuche bislang nicht entschlüsselten Voynich-Manuskript und widmen ein Kapitel den „Geheimsprachen in der Literatur“ (unter anderem dem Jugendjargon „Nadsat“ aus Anthony Burgess‘ Roman „A Clockwork Orange“). Zum wissenschaftlichen Anspruch des Bandes gehört ein Überblick über die Geheimsprachenforschung – und auch das ist, wie der gesamte Text, bei aller Wissenschaftlichkeit sehr gut lesbar.
Christian Efing u. Bruno Arich-Gerz: Geheimsprachen. Geschichte und Gegenwart verschlüsselter Kommunikation. Marix Verlag, Wiesbaden 2017.